Top Themen im Hinweisgeberschutz:
Für rechtssicheren Betrieb von Hinweisgebersystemen – intern oder via eMSB – ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung unverzichtbar. So identifizieren Sie Risiken und implementieren geeignete Schutzmaßnahmen.
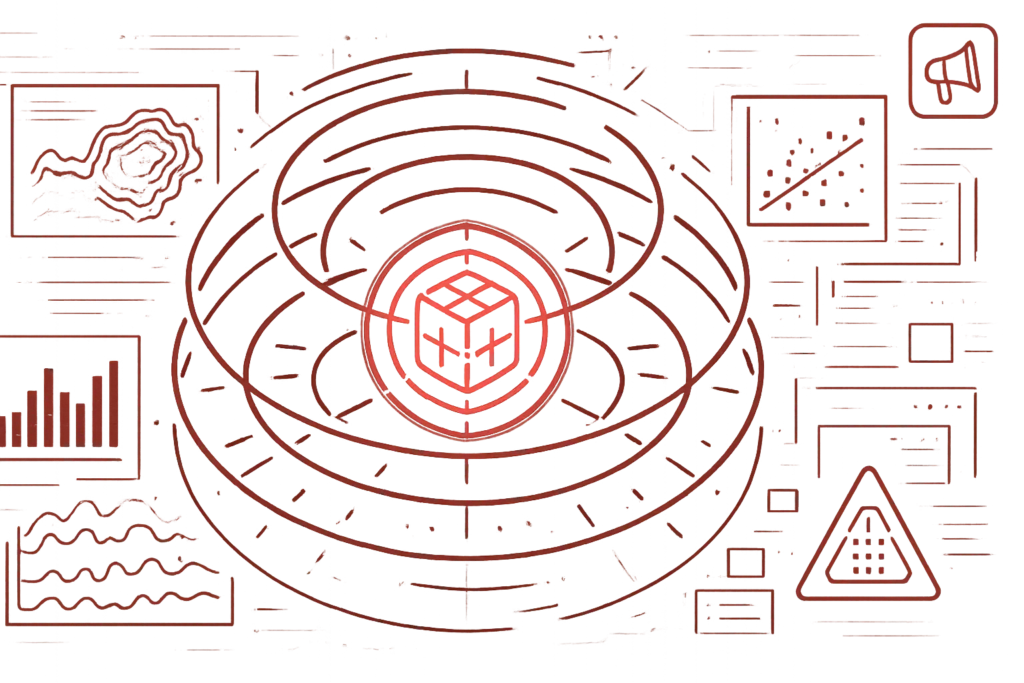
Das Hinweisgeberschutzgesetz: Am 2. Juli 2023 trat das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) in Kraft. Infolgedessen sind Unternehmen sowie kirchliche Stellen dazu verpflichtet, eine interne Meldestelle für alle Mitarbeitenden einzurichten. Dadurch soll vor allem der Schutz der Hinweisgeber (Whistleblower) gewährleistet werden. Da eingehende Meldungen mit personenbezogenen Daten verbunden sind, zieht dies datenschutzrechtliche Konsequenzen nach sich. Besonders, wenn die Meldungen nicht anonym abgegeben werden, führt dies zu einem erhöhten Risiko bezüglich der personenbezogenen Daten der in der Meldung involvierten Personen.
Eine Datenschutz-Folgenabschätzung ist ein präventives Instrument zur systematischen Bewertung von Datenschutzrisiken vor der Implementierung neuer Datenverarbeitungsprozesse. Sie dient nicht nur der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, sondern ermöglicht es Verantwortlichen, potenzielle Schwachstellen zu identifizieren und geeignete Schutzmaßnahmen zu entwickeln.
Im Kontext von Hinweisgebersystemen analysiert die DSFA die Konsequenzen der Verarbeitung personenbezogener Daten aller beteiligten Personen – sowohl der Hinweisgeber als auch der beschuldigten Personen. Dabei werden besondere Kategorien personenbezogener Daten berücksichtigt, die häufig in Meldungen enthalten sind, wie Informationen über strafrechtliche Verurteilungen oder Zuwiderhandlungen.
Die Durchführung einer DSFA ermöglicht es Unternehmen, Datenschutzkonformität zu gewährleisten und gleichzeitig das Vertrauen der Mitarbeitenden in das Meldesystem zu stärken. Durch die proaktive Risikoanalyse können teure Bußgelder und Reputationsschäden vermieden werden.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSeit dem 2. Juli 2023 sind Unternehmen und kirchliche Stellen durch das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) verpflichtet, interne Meldestellen einzurichten. Die Verarbeitung personenbezogener Daten in diesen Systemen birgt erhebliche datenschutzrechtliche Risiken und macht eine sorgfältige Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) unverzichtbar.
Die rechtliche Verpflichtung zur Durchführung einer DSFA ergibt sich aus Artikel 35 Absatz 1 DSGVO. Demnach ist eine Folgenabschätzung erforderlich, wenn die geplante Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat.
Artikel 35 Absatz 3 DSGVO definiert drei spezifische Fallgruppen, in denen eine DSFA zwingend erforderlich ist:
Zusätzlich haben die Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 35 Absatz 4 DSGVO Listen mit Verarbeitungsvorgängen erstellt, für die eine DSFA durchzuführen ist. Die Datenschutzkonferenz (DSK) hat eine entsprechende Muss-Liste veröffentlicht, die als Orientierungshilfe dient.
Obwohl interne Meldestellen nicht explizit in der DSK-Muss-Liste aufgeführt sind, sprechen mehrere Faktoren für die Notwendigkeit einer DSFA bei Hinweisgebersystemen:
Sensible Datenverarbeitung: Meldungen enthalten häufig besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 DSGVO, einschließlich Informationen über strafrechtliche Verurteilungen oder Zuwiderhandlungen nach Artikel 10 DSGVO. Diese Daten erfordern besonderen Schutz und erhöhen das Risiko für die betroffenen Personen erheblich.
Potenzielle Auswirkungen: Die Verarbeitung von Meldungen kann schwerwiegende Konsequenzen für beschuldigte Personen haben, einschließlich arbeitsrechtlicher Maßnahmen, Reputationsschäden oder sogar strafrechtlicher Verfolgung. Diese potenziellen Auswirkungen rechtfertigen eine umfassende Risikoanalyse.
Ungleichgewicht der Machtverhältnisse: Das Arbeitsverhältnis zwischen Hinweisgebern und Arbeitgebern schafft ein strukturelles Ungleichgewicht, das besondere Schutzmaßnahmen erforderlich macht. Hinweisgeber befinden sich in einer vulnerablen Position und sind auf angemessene Vertraulichkeitsmaßnahmen angewiesen.
Innovative Technologien: Moderne Hinweisgebersysteme nutzen oft neue Technologien wie verschlüsselte Kommunikationskanäle oder anonyme Meldemöglichkeiten. Gemäß Erwägungsgrund 91 DSGVO kann der Einsatz neuer Technologien eine DSFA erforderlich machen.
Das Arbeitspapier 248 des Europäischen Datenschutzausschusses liefert wichtige Kriterien für die Bewertung von Datenschutzrisiken. Diese Kriterien sind bei fast jeder Datenverarbeitung im Zusammenhang mit internen Meldungen erfüllt:
Bewertung oder Scoring: Hinweisgebersysteme bewerten inhaltlich die Glaubwürdigkeit und Relevanz eingehender Meldungen, was eine Form der Bewertung natürlicher Personen darstellt.
Automatisierte Entscheidungsfindung: Viele Systeme verwenden automatisierte Prozesse zur Kategorisierung und Weiterleitung von Meldungen, was rechtliche Auswirkungen für die betroffenen Personen haben kann.
Systematische Überwachung: Interne Meldestellen schaffen ein System zur systematischen Überwachung des Verhaltens von Mitarbeitenden, was die Arbeitsplatzkultur und das Vertrauen beeinträchtigen kann.
Die „Orientierungshilfe der Datenschutzaufsichtsbehörden zur Whistleblowing-Hotline“ stuft das Verfahren zur Meldung von Missständen als besonders riskant ein. Diese Einschätzung unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Datenschutz-Folgenabschätzung für interne Meldestellen.
Fachkunde erwerben für den Betrieb der internen Meldestelle: Zertifizierung für den Bereich Hinweisgebersystem nach EU-Richtlinie.
Schritt 1: Schwellenwertanalyse durchführen Zunächst ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine DSFA gemäß Artikel 35 DSGVO erfüllt sind. Dabei werden die Art der Daten, Verarbeitungsmethoden und potenziellen Auswirkungen auf die Betroffenen analysiert.
Schritt 2: Stakeholder-Analyse und Projektplanung Identifizieren Sie alle relevanten Stakeholder, einschließlich Datenschutzbeauftragten, IT-Abteilung, Rechtsabteilung und Betriebsrat. Entwickeln Sie einen detaillierten Projektplan mit Zeitrahmen und Verantwortlichkeiten.
Schritt 3: Systematische Beschreibung der Verarbeitungsvorgänge Dokumentieren Sie alle geplanten Verarbeitungstätigkeiten detailliert im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten:
Schritt 4: Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit Prüfen Sie, ob die geplante Datenverarbeitung zur Erreichung des Zwecks erforderlich und angemessen ist. Berücksichtigen Sie dabei alternative, weniger eingriffsintensive Maßnahmen.
Schritt 5: Risikoidentifikation und -bewertung Identifizieren Sie systematisch alle potenziellen Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. Bewerten Sie diese Risiken hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Auswirkungen.
Schritt 6: Entwicklung von Abhilfemaßnahmen Für jedes identifizierte Risiko sind geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu entwickeln. Diese können präventive, korrektive oder kompensatorische Maßnahmen umfassen.
Setzen Sie das HinSchG rechtssicher und stressfrei um mit unserer kostenlosen Checkliste! In nur 10 praktischen Schritten führen wir Sie zur vollständigen Compliance – vermeiden Sie teure Bußgelder und etablieren Sie eine professionelle Meldestelle, die wirklich funktioniert.

Technische Risiken:
Organisatorische Risiken:
Rechtliche Risiken:
Soziale und ethische Risiken:
Fallstudie: Großunternehmen im Finanzsektor
Ein internationales Finanzdienstleistungsunternehmen mit 15.000 Mitarbeitenden implementierte ein digitales Hinweisgebersystem. Die DSFA identifizierte folgende kritische Risiken:
Identifizierte Risiken:
Implementierte Maßnahmen:
Ergebnis: Das Unternehmen konnte durch die proaktive DSFA potenzielle Bußgelder in Millionenhöhe vermeiden und das Vertrauen der Mitarbeitenden in das System stärken.
Fehler 1: Oberflächliche Risikoanalyse Viele Unternehmen beschränken sich auf eine oberflächliche Betrachtung offensichtlicher Risiken. Eine umfassende DSFA erfordert jedoch die systematische Analyse aller Verarbeitungsschritte und potenziellen Auswirkungen.
Vermeidung: Nutzen Sie strukturierte Risikoanalysemethoden und beziehen Sie externe Datenschutzexperten ein.
Fehler 2: Vernachlässigung organisatorischer Aspekte Technische Maßnahmen allein reichen nicht aus. Organisatorische Schwachstellen wie unklare Zuständigkeiten oder mangelnde Schulungen können erhebliche Risiken darstellen.
Vermeidung: Entwickeln Sie umfassende Prozessdokumentationen und Schulungskonzepte für alle beteiligten Personen.
Fehler 3: Einmalige Durchführung ohne regelmäßige Überprüfung Eine DSFA ist kein einmaliger Vorgang, sondern erfordert regelmäßige Aktualisierungen, insbesondere bei Änderungen am System oder der Rechtslage.
Vermeidung: Implementieren Sie einen systematischen Review-Prozess mit festen Überprüfungsintervallen.
Fehler 4: Mangelnde Einbeziehung der Betroffenen Die Perspektive der betroffenen Personen wird oft vernachlässigt, obwohl deren Rechte und Freiheiten im Mittelpunkt der DSFA stehen sollten.
Vermeidung: Führen Sie Befragungen oder Workshops mit Vertretern der betroffenen Personengruppen durch.
Verantwortlicher (Controller): Die Geschäftsleitung trägt die Gesamtverantwortung für die Durchführung der DSFA und die Implementierung der erforderlichen Maßnahmen. Sie muss die notwendigen Ressourcen bereitstellen und strategische Entscheidungen treffen.
Datenschutzbeauftragter: Der Datenschutzbeauftragte spielt eine zentrale Rolle bei der DSFA. Er berät bei der Durchführung, überwacht die Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen und fungiert als Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörden.
IT-Abteilung: Die IT-Abteilung ist für die technische Umsetzung der Schutzmaßnahmen verantwortlich. Sie muss die technischen Risiken bewerten und geeignete Sicherheitsmaßnahmen implementieren.
Rechtsabteilung: Die Rechtsabteilung prüft die rechtlichen Aspekte der DSFA und stellt sicher, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Sie berät auch bei der Bewertung rechtlicher Risiken.
Betriebsrat/Personalvertretung: Bei Vorhandensein einer Personalvertretung muss diese gemäß den betriebsverfassungsrechtlichen Bestimmungen einbezogen werden, da Hinweisgebersysteme die Mitarbeiterrechte berühren.
Externe Dienstleister: Wird ein externer Meldestellenbeauftragter eingesetzt, muss dieser eng in die DSFA einbezogen werden. Als Auftragsverarbeiter trägt er Mitverantwortung für die datenschutzkonforme Umsetzung.
Bußgeldrisiken: Die Nichtdurchführung einer erforderlichen DSFA kann nach Artikel 83 Absatz 4 DSGVO mit Bußgeldern von bis zu 10 Millionen Euro oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes geahndet werden. Die Aufsichtsbehörden haben in der Vergangenheit bereits erhebliche Bußgelder für unterlassene DSFAs verhängt.
Haftungsrisiken: BeiDatenschutzverletzungen aufgrund unzureichender Risikoanalyse können erhebliche Schadensersatzansprüche entstehen. Betroffene Personen haben nach Artikel 82 DSGVO Anspruch auf Ersatz materieller und immaterieller Schäden.
Reputationsschäden: Datenschutzverletzungen in Hinweisgebersystemen können zu erheblichen Reputationsschäden führen und das Vertrauen von Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern nachhaltig beeinträchtigen.
Operative Risiken: Ohne angemessene Risikoanalyse steigt die Wahrscheinlichkeit von Systemproblemen, Sicherheitsvorfällen und Compliance-Verstößen. Dies kann zu kostspieligen Nachbesserungen und Systemausfällen führen.
Die All-in-One Software für den Betrieb einer internen Meldestelle mit Bestpreisgarantie.
Ist eine DSFA für jedes Hinweisgebersystem zwingend erforderlich? Obwohl interne Meldestellen nicht explizit in der DSK-Muss-Liste stehen, empfehlen wir dringend die Durchführung einer DSFA. Der Europäische Datenschutzausschuss und deutsche Aufsichtsbehörden stufen Whistleblowing-Verfahren als besonders risikobehaftet ein, da sie sensible personenbezogene Daten verarbeiten und schwerwiegende Konsequenzen für Betroffene haben können.
Kann eine DSFA nachträglich durchgeführt werden? Grundsätzlich ja, jedoch ist dies mit erhöhten Risiken und Kosten verbunden. Eine nachträgliche DSFA kann notwendige Systemänderungen aufdecken, die in der bereits implementierten Infrastruktur schwer umsetzbar sind. Zudem besteht bis zur Durchführung ein erhöhtes Bußgeldrisiko.
Wie oft muss eine DSFA aktualisiert werden? Eine Aktualisierung ist erforderlich bei wesentlichen Änderungen am System, neuen Rechtsnormen oder wenn neue Risiken identifiziert werden. Als Best Practice empfiehlt sich eine jährliche Überprüfung sowie eine Aktualisierung bei größeren Systemänderungen oder nach Sicherheitsvorfällen.
Muss die DSFA der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden? Nur in bestimmten Fällen gemäß Artikel 36 DSGVO, wenn trotz Abhilfemaßnahmen ein hohes Risiko verbleibt, ist eine Vorabkonsultation mit der Aufsichtsbehörde erforderlich. Eine proaktive Vorlage kann jedoch das Vertrauen der Aufsichtsbehörde stärken und bei späteren Prüfungen vorteilhaft sein.
Welche Bußgelder drohen bei fehlender DSFA? Die Nichtdurchführung einer erforderlichen DSFA kann mit Bußgeldern von bis zu 10 Millionen Euro oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes geahndet werden. Zusätzlich können bei daraus resultierenden Datenschutzverletzungen weitere Bußgelder und Schadensersatzansprüche entstehen.
Wer sollte die DSFA durchführen? Die DSFA sollte von einem interdisziplinären Team durchgeführt werden, bestehend aus Datenschutzbeauftragten, IT-Experten, Rechtsabteilung und Fachverantwortlichen. Die Einbindung externer Datenschutzexperten ist besonders bei komplexen Systemen empfehlenswert.
Wie lange dauert eine DSFA für ein Hinweisgebersystem? Die Dauer hängt von der Komplexität des Systems ab. Für einfache Systeme sind 4-6 Wochen realistisch, komplexe internationale Systeme können 3-6 Monate benötigen. Die Planung sollte ausreichend Zeit für Stakeholder-Konsultationen und Maßnahmenentwicklung einschließen.
Welche Kosten entstehen bei einer DSFA? Die Kosten variieren stark je nach Systemkomplexität und interner Ressourcenverfügbarkeit. Bei externer Beauftragung können Kosten zwischen 15.000€ und 50.000€ entstehen. Diese Investition ist jedoch geringer als potenzielle Bußgelder oder Schadensersatzansprüche.
Können bestehende Risikoanalysen für die DSFA verwendet werden? Ja, vorhandene IT-Sicherheitsanalysen oder Compliance-Bewertungen können als Grundlage dienen, müssen jedoch um spezifische Datenschutzaspekte erweitert werden. Eine reine IT-Sicherheitsanalyse reicht für eine DSFA nicht aus.
Was passiert, wenn die DSFA hohes Risiko attestiert? Bei verbleibendem hohem Risiko nach Implementierung von Schutzmaßnahmen ist eine Vorabkonsultation mit der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 36 DSGVO erforderlich. Dies ist jedoch selten der Fall, wenn angemessene Maßnahmen ergriffen werden.
Welche technischen Maßnahmen sind besonders wichtig? End-to-End-Verschlüsselung, rollenbasierte Zugriffskontrollen, sichere Authentifizierung, regelmäßige Sicherheitsupdates und Anonymisierungstechnologien sind essentiell. Zusätzlich sollten Logging und Monitoring implementiert werden, um unbefugte Zugriffe zu erkennen.
Wie kann Anonymität technisch gewährleistet werden? Echte Anonymität ist technisch herausfordernd. Pseudonymisierung, Tor-Integration, zeitversetzte Weiterleitung und die Vermeidung von Metadaten-Sammlung können helfen. Vollständige Anonymität kann jedoch die rechtlich erforderliche Rückverfolgbarkeit bei strafrechtlich relevanten Meldungen beeinträchtigen.
Welche organisatorischen Maßnahmen sind erforderlich? Klare Rollen und Verantwortlichkeiten, umfassende Schulungen, Incident-Response-Verfahren, regelmäßige Audits und eine Kultur des Datenschutzes sind unerlässlich. Besonders wichtig ist die Sensibilisierung aller beteiligten Personen für Vertraulichkeit.
Wie lange dürfen Daten gespeichert werden? Die Speicherdauer muss sich am Verarbeitungszweck orientieren. Für laufende Verfahren ist eine Speicherung bis zum Abschluss zulässig. Danach sollten Daten gelöscht oder anonymisiert werden, es sei denn, gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Typische Fristen liegen zwischen 3-10 Jahren.
Wie gehe ich mit anonymen Meldungen um? Auch anonyme Meldungen erfordern datenschutzrechtliche Beachtung, da sie personenbezogene Daten über beschuldigte Personen enthalten können. Die DSFA muss beide Perspektiven berücksichtigen und angemessene Schutzmaßnahmen für alle Betroffenen vorsehen.
Was ist bei internationalen Konzernen zu beachten? Bei internationaler Datenübermittlung müssen zusätzlich die Anforderungen der Artikel 44ff DSGVO beachtet werden. Angemessenheitsbeschlüsse, Standardvertragsklauseln oder Binding Corporate Rules können erforderlich sein. Die DSFA muss diese grenzüberschreitenden Aspekte berücksichtigen.
Wie werden Beschuldigtenrechte gewährleistet? Beschuldigte Personen haben grundsätzlich die gleichen Datenschutzrechte wie andere Betroffene. Dies kann jedoch mit der Vertraulichkeit der Hinweisgeber kollidieren. Die DSFA muss einen angemessenen Ausgleich zwischen diesen widerstreitenden Interessen finden.
Müssen auch externe Meldestellen eine DSFA durchführen? Ja, auch bei Beauftragung externer Meldestellenbeauftragter bleibt der Verantwortliche in der Pflicht. Die DSFA muss die gesamte Verarbeitungskette einschließlich externer Dienstleister berücksichtigen und entsprechende Auftragsverarbeitungsverträge abschließen.
Wie wird die Qualität einer DSFA bewertet? Eine qualitativ hochwertige DSFA zeichnet sich durch systematische Risikoidentifikation, nachvollziehbare Bewertungskriterien, angemessene Schutzmaßnahmen und regelmäßige Überprüfung aus. Externe Audits können die Qualität zusätzlich sicherstellen.
Welche Dokumentation ist erforderlich? Die DSFA muss vollständig dokumentiert werden, einschließlich Verarbeitungsbeschreibung, Risikoanalyse, Schutzmaßnahmen und Überwachungsverfahren. Diese Dokumentation muss bei Behördenanfragen vorgelegt werden können.
Wie werden Mitarbeitende in die DSFA einbezogen? Mitarbeitende sollten sowohl als Stakeholder in den DSFA-Prozess als auch als Zielgruppe von Schulungsmaßnahmen einbezogen werden. Ihre praktischen Erfahrungen können wertvolle Einblicke in potenzielle Risiken liefern.
Was sind die nächsten Schritte nach Abschluss der DSFA? Nach Abschluss der DSFA müssen die identifizierten Schutzmaßnahmen implementiert, Schulungen durchgeführt und ein Monitoring-System etabliert werden. Ein regelmäßiger Review-Prozess stellt sicher, dass die DSFA aktuell bleibt und bei Änderungen angepasst wird.
Als ext. MSB unterstützen wir Sie bei der Einrichtung einer internen Meldestelle und übernehmen für Sie die Bearbeitung eingereichter Hinweise.
Wir unterstützen Unternehmen dabei, die Anforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) praxisnah und rechtssicher umzusetzen – digital, so einfach wie möglich und zu fixen Konditionen. Als spezialisierter Beratungsdienstleister und externer Meldestellenbeauftragter stellen wir sicher, dass Ihre interne Meldestelle alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt und Ihre Organisation vor rechtlichen sowie reputativen Risiken geschützt ist.


Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen