Top Themen im Hinweisgeberschutz:
Die interne Meldestelle bildet das Herzstück jedes HinSchG-konformen Hinweisgebersystems. Doch welche rechtlichen Anforderungen gelten konkret? Software, eMSB und unsere kostenlose Checkliste bieten bewährte Lösungen.
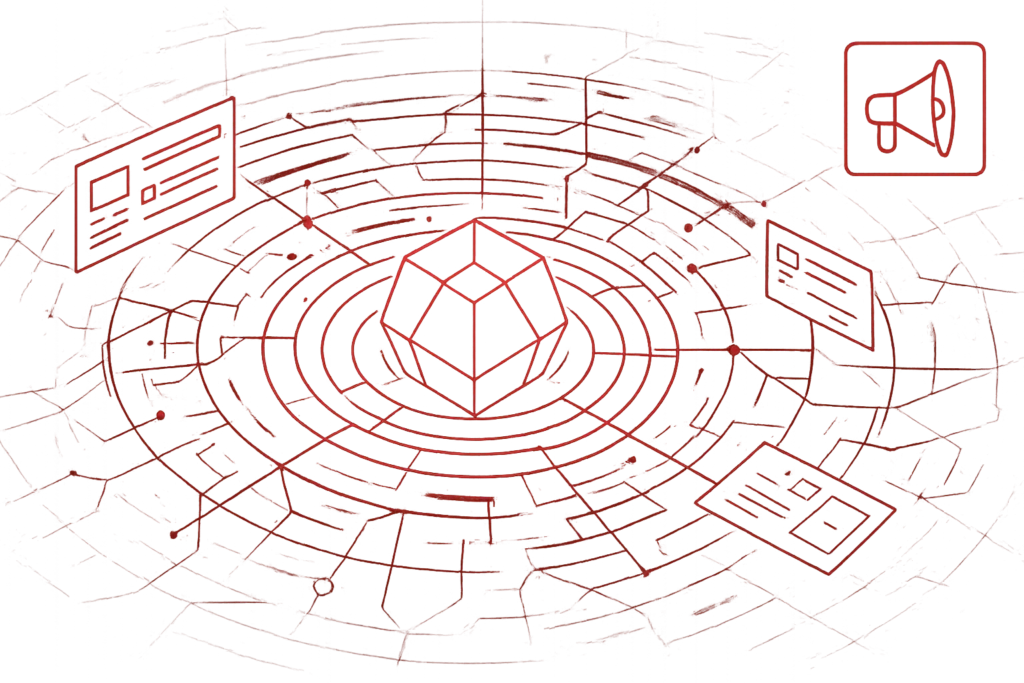
Eine interne Meldestelle ist eine organisatorische Einheit eines Unternehmens, die gemäß dem Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) verantwortlich für den Empfang, die Prüfung und weitere Bearbeitung von Hinweisen auf Missstände ist.
Sie umfasst neben den Meldekanälen auch organisatorische und technische Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz, Anonymität und effektiver Fallbearbeitung.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenBei einem Meldekanal handelt es sich um einen Kommunikationsweg respektive ein Verfahren, über das Hinweisgebende Meldungen über mögliche Verstöße abgeben können. Bei der Ausgestaltung eines Meldekanals gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir weiter unten näher beleuchten.
Einige dieser Ausgestaltungen bieten die Möglichkeit, Meldungen in anonymer Form einzureichen, sodass die Identität der Hinweisgebenden geschützt wird.
Ein Meldekanal dient primär der Entgegennahme von eingehenden Hinweisen. Er soll das Einreichen von Meldungen für Hinweisgebende erleichtern und stellt eine zentrale Anlaufstelle für all diejenigen dar, die Fehlverhalten oder Verstöße melden möchten.
Als Teil der internen Meldestelle bietet ein gut strukturierter Meldekanal die Möglichkeit der effizienten Bearbeitung dieser Hinweise und trägt zur HinSchG-Konformität eines Unternehmens bei.
Das HinSchG gibt nicht vor, in welcher Form ein Unternehmen den Meldekanal einrichten muss. Dennoch enthält es einige Anforderungen, die ein Meldekanal erfüllen muss. Zum einen ist der Meldekanal so einzurichten, dass die Vertraulichkeit und der Datenschutz der Hinweisgeber stets gewährleistet wird.
Außerdem muss eine Dokumentation der Meldung sowie ergriffener Maßnahmen möglich sein. Jedes Unternehmen, das einen Meldekanal einrichtet, muss zwingend dafür sorgen, dass dieser für alle Hinweisgeber frei zugänglich und Barrierefreiheit gegeben ist. Ein geeigneter Meldekanal muss darüber hinaus die Möglichkeit eröffnen, Hinweise entweder in schriftlicher oder in Sprachform einzureichen.
Das Hinweisgeberschutzgesetz, das am 2. Juli 2023 in Kraft getreten ist, setzt die EU-Whistleblower-Richtlinie 2019/1937 in deutsches Recht um. Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten sind zur Einrichtung einer internen Meldestelle verpflichtet, während Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten eine Übergangsfrist bis zum 17. Dezember 2023 hatten.
Die Meldestelle fungiert als zentrale Anlaufstelle für Hinweisgeber, die Verstöße gegen EU-Recht oder bestimmte nationale Gesetze melden möchten. Der Anwendungsbereich des HinSchG umfasst verschiedene Rechtsbereiche, darunter öffentliche Auftragsvergabe, Finanzdienstleistungen, Geldwäscheprävention, Produktsicherheit, Verkehrssicherheit, Umweltschutz, Strahlenschutz und Datenschutz.
Besonders wichtig ist die rechtliche Absicherung der Hinweisgeber: Das Gesetz verbietet explizit Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Meldungen abgeben. Verstöße gegen diese Schutzbestimmungen können mit Bußgeldern bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Die Meldestelle muss unabhängig agieren und verfügt über weitreichende Befugnisse zur Aufklärung gemeldeter Sachverhalte, einschließlich der Durchführung von Interviews und der Einsichtnahme in relevante Dokumente.
Unternehmen haben die Möglichkeit, die Verantwortung für ihr Melde- und Hinweisgebersystem an unabhängige Dritte als externe Meldestellenbeauftragte übertragen. Dies bietet ihnen vor allem die folgenden Vorteile:
Die interne Meldestelle übernimmt vielfältige Aufgaben: Sie nimmt Hinweise entgegen, prüft deren Berechtigung, leitet Untersuchungen ein und koordiniert Folgemaßnahmen. Dabei muss sie stets die Vertraulichkeit wahren und angemessene Fristen einhalten. Eine ordnungsgemäße Dokumentation aller Verfahrensschritte ist gesetzlich vorgeschrieben.
Bei der Betreuung der internen Meldestelle stehen Unternehmen zwei grundlegende Optionen zur Verfügung, die sich hinsichtlich Kosten, Fachkompetenz und rechtlicher Sicherheit erheblich unterscheiden.
Interner MSB (⌀ 300-400€ / Monat) | Externer MSB (125€ / Monat Festpreis) |
|---|---|
✔ Keine extra Lohnkosten Ein interner MSB kann auch weitere Aufgaben für das Unternehmen erledigen. (Evtl. erhöhtes Gehalt durch Mehraufwand) | ✔ Transparente und planbare Kosten Pauschalpakete bieten Kostentransparenz. Die Auslagerung der Arbeit spart intern Zeit. |
✔ Vertrauen der Angestellten Das Vertrauen auf die Qualität der Leistung muss nicht erst gewonnen werden. | ✔ Expertise & langjährige Erfahrung Vertrauen wird durch Qualität geschaffen. Die langjährige Erfahrung unserer Experten schafft effiziente Prozesse. |
✘ Gefahr der Betriebsblindheit Interne Mitarbeiter stecken oft tief in den Unternehmensstrukturen und haben Schwierigkeiten objektiv auf diese zu schauen. | ✔ Objektive Außenperspektive Ein objektiver Blickwinkel und persönliche Distanz zu Mitarbeitern sind für die Findung & Umsetzung der Maßnahmen von Vorteil. |
✘ Haftungsrisiko für das Unternehmen Das Unternehmen haftet für das Handeln der eigenen Mitarbeiter. Im Falle eines Verstoßes kann dies sehr teuer werden. | ✔ Kein Risiko für das Unternehmen Durch die Umsetzung des HinSchG mithilfe eines externen Experten sind Sie auf der sicheren Seite und schützen sich vor hohen Bußgeldern. |
✘ Kündigungsschutz Interne Mitarbeiter unterliegen dem Kündigungsschutz. | ✔ Variable Vertragslaufzeit Der Vertrag mit einem externen Meldestellenbeauftragten kann jederzeit zur vereinbarten Frist gekündigt werden. |
✘ Zusatzkosten Das Erwerben von Qualifikationen für einen Meldestellenbeauftragten bringt Kosten für das Unternehmen mit sich. | ✔ Keine Ausbildungskosten Der MSB trägt alle Kosten für seine Fort- und Weiterbildungen. |
✔ Datenschutz inklusive Manche Dienstleister verfügen außerdem über die Qualifikation im Bereich der DSGVO und können diesen gleichzeitig abdecken. |
Briefkasten/Kummerkasten: Der klassische Briefkasten erfüllt nicht die Anforderungen des HinSchG. Ein Dialog zwischen Hinweisgeber und Meldestelle ist nicht möglich, was die Aufklärung erheblich erschwert. Diese analoge Lösung bietet unzureichenden Datenschutz, da die Identität von Hinweisgebern durch Handschrift oder andere Merkmale preisgegeben werden kann.
Telefon-Hotline: Telefonische Meldekanäle bringen verschiedene Nachteile mit sich: hohe Hemmschwelle bei kritischen Inhalten, keine Anonymitätsgarantie durch Stimmerkennung und Anrufer-IDs, Sprachbarrieren in internationalen Unternehmen sowie fehlende automatische Eingangsbestätigung.
E-Mail-Postfach: E-Mail-basierte Kanäle weisen erhebliche Sicherheitsrisiken auf: Datenverarbeitung im Ausland, Anfälligkeit für Hacking, unzureichende Verschlüsselung und gefährdete Anonymität durch E-Mail-Adressen und IP-Tracking. Die gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrung kann nicht sichergestellt werden.
Persönliche Gespräche/Ombudsperson: Eine Ombudsperson ist grundsätzlich gesetzeskonform, bringt jedoch praktische Nachteile: zeitlich begrenzte Verfügbarkeit, Unbehagen bei sensiblen Gesprächen, höhere Personalkosten und zusätzlicher Dokumentationsaufwand.
Digitale Meldesysteme: Moderne digitale Meldesysteme erfüllen alle Anforderungen des HinSchG optimal und bieten deutliche Vorteile gegenüber analogen Verfahren:
Das HinSchG stellt strenge Anforderungen an den Schutz von Hinweisgebern, die weit über herkömmliche Datenschutzbestimmungen hinausgehen. Meldekanäle müssen absolute Vertraulichkeit gewährleisten und dürfen die Identität von Hinweisgebern nicht preisgeben. Dies umfasst sowohl technische Schutzmaßnahmen als auch organisatorische Vorkehrungen zur Wahrung der Anonymität.
Technische Schutzmaßnahmen: Digitale Meldesysteme erfüllen diese Anforderungen durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sichere Datenübertragung und anonyme Kommunikationsmöglichkeiten. Moderne Systeme verwenden fortschrittliche Verschlüsselungsalgorithmen wie AES-256 und nutzen sichere Übertragungsprotokolle wie TLS 1.3. IP-Adressen werden anonymisiert oder gar nicht erst gespeichert, und die Kommunikation erfolgt über sichere, zeitlich begrenzte Token-Systeme.
Organisatorische Maßnahmen: Nur ausgewählte, besonders geschulte Personen dürfen Zugang zu den Meldedaten haben. Diese unterliegen einer erweiterten Verschwiegenheitspflicht und müssen regelmäßig in Datenschutzbestimmungen geschult werden. Ein mehrstufiges Berechtigungskonzept stellt sicher, dass verschiedene Personen nur Zugang zu den für ihre Aufgaben notwendigen Informationen haben.
Datenminimierung und Speicherbegrenzung: Gemäß dem Grundsatz der Datenminimierung dürfen nur die für die Bearbeitung notwendigen personenbezogenen Daten erhoben werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrung von Daten für drei Jahre nach Verfahrensabschluss muss technisch sauber umgesetzt werden, mit automatischen Löschfunktionen nach Ablauf der Frist.
Rechte der betroffenen Personen: Hinweisgeber haben besondere Rechte bezüglich ihrer Daten, einschließlich des Rechts auf Auskunft, Berichtigung und unter bestimmten Umständen auch Löschung. Gleichzeitig müssen diese Rechte gegen die Notwendigkeit der Aufklärung von Missständen abgewogen werden. Ein komplexes rechtliches Spannungsfeld, das professionelle juristische Begleitung erfordert.
Grundsätzlich gilt, dass alle Meldungen, die
vom HinSchG abgedeckt werden.
Nicht unter das HinSchG fallen also Anfragen oder Beschwerden, die keine rechtswidrigen Handlungen oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreffen. Allgemeine Anfragen zu Produkten oder Dienstleistungen sowie Beschwerden über mangelnden Kundenservice fallen nicht in den Anwendungsbereich des HinSchG.
Diese Vorfälle können bei der Beurteilung, ob einem Hinweis nachgegangen werden sollte, als Anhaltspunkte dienen:
Hinweis: Das HinSchG deckt keine allgemeine Meldepflicht für alle möglichen Anfragen oder Beschwerden ab. Es gilt speziell für Hinweise auf rechtswidriges Verhalten in bestimmten Kontexten, wie beispielsweise in Unternehmen, Behörden oder Organisationen.
Sollten Hinweisgeber einen Hinweis telefonisch abgeben, können sie die untenstehenden Schritte befolgen/vornehmen, um ihre Anonymität zu gewährleisten.
Hinweis: Diese Maßnahmen können zwar zur Anonymität beitragen, bieten dafür jedoch keine absolute Garantie.
Die All-in-One Software für den Betrieb einer internen Meldestelle mit Bestpreisgarantie.
Schritt 1: Verantwortlichkeiten definieren Die Auswahl geeigneter Meldestellenbeauftragter ist entscheidend für den Erfolg des Hinweisgebersystems. Interne Beauftragte müssen über entsprechende Fachkunde verfügen und absolute Unabhängigkeit gewährleisten können – sie dürfen nicht in Bereichen tätig sein, die häufig Gegenstand von Meldungen sind.
Alternativ bietet die Beauftragung eines externen Dienstleisters verschiedene Vorteile: Externe Meldestellenbeauftragte bringen bereits die erforderliche Fachkompetenz mit, sind per Definition unabhängig und haften für die ordnungsgemäße Verfahrensbearbeitung.
Schritt 2: Interne Richtlinien entwickeln Die Entwicklung umfassender Verfahrensrichtlinien muss verschiedene Aspekte berücksichtigen: klare Definitionen meldepflichtiger Sachverhalte, Verfahrensabläufe mit konkreten Fristen sowie Schutzmaßnahmen für alle Beteiligten.
Besonders wichtig ist die Regelung verschiedener Meldungstypen und Eskalationswege, falls die Geschäftsführung selbst von Vorwürfen betroffen ist. Komplexe Sachverhalte erfordern oft die Einbindung externer Ermittler oder Rechtsanwälte.
Schritt 3: Kommunikationsstrategie festlegen Eine durchdachte Kommunikationsstrategie ist essentiell für die Akzeptanz. Die mehrstufige Information sollte mit einer Ankündigung durch die Geschäftsführung beginnen, gefolgt von detaillierten Informationsveranstaltungen.
Wichtig ist die positive Darstellung als Schutz- und Präventionsinstrument. Transparente Kommunikation über Verfahrensabläufe und regelmäßige Updates halten das Thema im Bewusstsein der Belegschaft.
Moderne Softwarelösungen bieten All-in-One-Pakete für den Betrieb einer HinSchG-konformen internen Meldestelle. Diese umfassen sichere Meldeportale, automatisierte Workflows und umfassende Dokumentationsfunktionen. Bei der Auswahl geeigneter Software sollten Unternehmen verschiedene Kriterien berücksichtigen:
Sicherheitsanforderungen:
Funktionale Anforderungen:
Compliance-Features:
Integration und Skalierbarkeit:
Die Implementierung sollte in Phasen erfolgen: Nach der initialen Konfiguration folgt eine Testphase mit ausgewählten Nutzern, bevor die vollständige Freischaltung für alle Beschäftigten erfolgt. Wichtig ist die kontinuierliche Überwachung der Systemleistung und regelmäßige Updates zur Aufrechterhaltung der Sicherheitsstandards.
Die Vorteile digitaler Lösungen überwiegen deutlich:
Fallbeispiel Fertigungsunternehmen (200 Mitarbeiter): Ein mittelständischer Maschinenbauer implementierte eine digitale Meldelösung nach anfänglichen Überlegungen zu analogen Alternativen. Innerhalb von sechs Monaten wurden drei relevante Hinweise über das System gemeldet, darunter ein Fall von Korruption und zwei Verstöße gegen Arbeitssicherheitsbestimmungen. Die anonyme Meldemöglichkeit führte zu einer höheren Meldebereitschaft der Belegschaft.
Fallbeispiel Dienstleistungsunternehmen (150 Mitarbeiter): Ein IT-Dienstleister entschied sich für einen externen Meldestellenbeauftragten in Kombination mit einer Softwarelösung. Diese Kombination erwies sich als besonders effektiv, da Interessenkonflikte vermieden und Fachkompetenz sichergestellt wurden. Die Lösung führte zu erhöhtem Vertrauen der Mitarbeiter und proaktiver Compliance-Kultur.
Herausforderung: Geringe Akzeptanz bei MitarbeiternLösung: Umfassende Kommunikation über Zweck und Schutzmaßnahmen, Schulungen für Führungskräfte und transparente Darstellung des Verfahrens. Wichtig ist die Betonung, dass die Meldestelle dem Schutz aller Beteiligten dient und nicht als „Petze-System“ zu verstehen ist.
Herausforderung: Technische Überforderung bei der ImplementierungLösung: Auswahl benutzerfreundlicher Softwarelösungen mit professionellem Support und Schulungsangeboten. Cloud-basierte Systeme reduzieren den internen IT-Aufwand erheblich.
Herausforderung: Umgang mit unbegründeten oder böswilligen MeldungenLösung: Klare Verfahrensregeln für die Bewertung von Hinweisen und angemessene Aufklärungsmaßnahmen. Ein strukturiertes Erstbewertungsverfahren hilft bei der schnellen Einschätzung der Relevanz.
Herausforderung: Ressourcenmangel für den Betrieb der MeldestelleLösung: Beauftragung externer Meldestellenbeauftragter oder Nutzung vollautomatisierter Softwarelösungen. Die Kosten-Nutzen-Analyse zeigt oft Vorteile externer Lösungen.
Digitale Meldesysteme bieten die beste Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und HinSchG-Compliance. Sie senken Hemmschwellen für Hinweisgeber, gewährleisten absolute Anonymität und ermöglichen eine effiziente Bearbeitung aller Meldungen. In Verbindung mit professionellen externen Meldestellenbeauftragten entsteht eine Lösung, die sowohl rechtliche Sicherheit als auch praktische Vorteile bietet.
Die Investition in eine moderne, digitale interne Meldestelle schützt Unternehmen nicht nur vor rechtlichen Risiken, sondern trägt auch zur Entwicklung einer offenen und vertrauensvollen Unternehmenskultur bei. Die korrekte Umsetzung aller Anforderungen gewährleistet dabei sowohl Compliance als auch praktische Effizienz.
Setzen Sie das HinSchG rechtssicher und stressfrei um mit unserer kostenlosen Checkliste! In nur 10 praktischen Schritten führen wir Sie zur vollständigen Compliance – vermeiden Sie teure Bußgelder und etablieren Sie eine professionelle Meldestelle, die wirklich funktioniert.

Meldeberechtigt sind nach dem HinSchG alle Beschäftigten, ehemalige Mitarbeiter, Bewerber, Praktikanten, Lieferanten und weitere Dritte, die im beruflichen Kontext Kenntnis von Verstößen erhalten haben. Die interne Meldestelle muss für alle diese Personengruppen barrierefrei zugänglich sein.
Die Vertraulichkeit wird durch technische Verschlüsselung, beschränkten Zugang zu Meldedaten, Verschwiegenheitspflicht der Meldestellenbeauftragten und strikte Verfahrensregeln gewährleistet. Hinweisgeber können zwischen anonymer Meldung und Meldung mit Namensnennung wählen. Digitale Meldesysteme bieten dabei den höchsten Schutzstandard.
Unternehmen müssen Hinweise binnen 7 Tagen bestätigen und innerhalb von 3 Monaten über getroffene Maßnahmen informieren. Bei komplexen Fällen ist eine Verlängerung auf 6 Monate möglich. Alle Verfahrensschritte sind zu dokumentieren und 3 Jahre nach Verfahrensabschluss aufzubewahren.
Der Meldeprozess erfolgt in folgenden Schritten: 1) Eingang der Meldung über den Meldekanal, 2) Eingangsbestätigung binnen 7 Tagen, 3) Prüfung der Zuständigkeit und Berechtigung, 4) Untersuchung des gemeldeten Sachverhalts, 5) Entscheidung über erforderliche Maßnahmen, 6) Rückmeldung an den Hinweisgeber binnen 3 Monaten. Digitale Systeme automatisieren viele dieser Schritte.
Geeignete Software für interne Meldestellen muss HinSchG-Compliance, sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Anonymitätsschutz, automatische Dokumentation und DSGVO-konforme Datenspeicherung in Deutschland bieten. Wichtig sind außerdem benutzerfreundliche Bedienung, 24/7-Verfügbarkeit und professioneller Support mit regelmäßigen Updates.
Die All-in-One Software für den Betrieb einer internen Meldestelle mit Bestpreisgarantie.
Wir unterstützen Unternehmen dabei, die Anforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) praxisnah und rechtssicher umzusetzen – digital, so einfach wie möglich und zu fixen Konditionen. Als spezialisierter Beratungsdienstleister und externer Meldestellenbeauftragter stellen wir sicher, dass Ihre interne Meldestelle alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt und Ihre Organisation vor rechtlichen sowie reputativen Risiken geschützt ist.


Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen